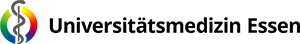Gott ist ein Taxifahrer, der uns alle abholt
Ulrike, 52 Jahre, Hospizarbeit, Essen
Ich hatte vor einiger Zeit eine hospizliche Begleitung in der Tumorklinik. Ihr Name war Gaby, sie war 20 Jahre alt und litt seit ca. zwei Jahren an NHL (Non-Hodgkin-Lymphom) mit diversen unterschiedlichen Chemotherapie-Versuchen. Die Erkrankung war bei der Einstellungsuntersuchung für eine Lehrstelle, die Gaby nach ihrem Abi hatte antreten wollen, festgestellt worden. Seit nun mehr zwei Jahren hatte Gaby das Krankenhaus so gut wie nicht mehr verlassen.
Gabys Freunde und Klassenkameraden aus der Schulzeit waren in alle Welt verstreut: Bundeswehr, Studium, Au‑pair, Weltreise. Gaby hatte eine kleine Schwester, die ihr sehr wichtig war, und um die sie sich Sorgen machte, weil die Mutter schon längere Zeit unter Depressionen litt und Gaby für ihre Schwester die Mutterrolle übernommen hatte.
Das Verhältnis zur Mutter war schwierig: Viel Streit bei gleichzeitiger Beschützerhaltung Gabys ihrer kranken Mutter gegenüber. Offen über ihre Erkrankung sprechen konnte oder wollte Gaby weder mit ihrer Mutter noch mit ihrer Schwester.
Gaby kam aus der ehemaligen DDR, war weder getauft, noch hatte sie sich mit Religion beschäftigt. Primäre somatische Problematik war eine Verlegung der Harnleiter sowie zunehmende Luftnot mit Panikattacken, die sich durch kalte Frischluft und vor allem durch Anwesenheit eines Menschen in der Nähe lindern ließen. Eine Schmerztherapie mit Opiaten war erfolgreich: Gaby war relativ schmerzfrei und wie sie sich gewünscht hatte auch recht wach und kommunikationsfähig.
Eines Abends fragte sie mich, wie ich mir das so vorstelle, wenn ich einmal sterben müsse, wohin man dann kommt und wie es dann eigentlich so weitergeht. Auf meine Gegenfrage, was sie nun gern hören wolle, antwortete sie, sie stelle sich vor, Gott sei ein Taxifahrer. Persönlich hole er jeden Menschen ab und ihr Taxi würde auch bald kommen.
Gemeinsam stellten wir uns dann ihr Taxi vor. Mal sah es aus, wie die Taxis in London, dicke schwarze Autos, in denen man auf dem glatten Kunstleder der Rückbank hin und her rutschte, mal wie ein Yellow-Cab im New-York-Style. Dann setzten wir uns in das Taxi und fuhren los. Der Fahrer, so malten wir uns aus, hatte Philosophie und Theologie studiert und sah sehr freundlich und ein bisschen ungewaschen aus.
Dann beschrieb Gaby, welche Städte und Orte wir anfahren sollten: New York, Paris, Neuseeland, die Uckermark, ein Reiseziel aus Gabys Kindheit, Los Angeles, Mailand, die spanische Riviera. Manchmal reisten wir auch durch die Zeit und besuchten Gabys Schwester in der Zukunft, in der sie studierte, verheiratet war und viel durch die Welt reiste.
Hin und wieder sollte auch ich beschreiben, was ich sah. Mit der Zeit wurde mein Sprechanteil größer, Gabys Kräfte ließen sichtbar nach. Ich beschrieb also, welche Landschaft wir gerade durchfuhren, die Schweizer Alpen, Sylt, die Galapagos-Inseln und Gaby gab durch Gestik ihr Einverständnis oder zu verstehen, dass sie ein anderes „Bild“ haben wollte.
Zwischendurch schliefen wir beide phasenweise ein und nahmen die Phantasiereise danach wieder auf.
Gegen 3:00 Uhr nachts sagte sie plötzlich nach langer Sprechpause laut und mit erstaunlich fester Stimme: „Jetzt musst du aussteigen.“
Ich folgte ihrem Wunsch. Das Bild, wie ich am Straßenrand stehe und dem Taxi nachblicke, Gaby winkt mir dabei freundlich aus dem Rückfenster zu, werde ich nie vergessen.
Etwa um 3:30 Uhr starb sie. Wohin sie gefahren ist, bleibt wohl ihr Geheimnis, aber ich bin sicher: Als sie wegfuhr war sie gesund, hoffnungsvoll und heil.
Meine ganz persönliche Frage bleibt: Was ist Heilung, was ist Wahrheit und was ist Hoffnung?